Rezension zu: Peaslee, Robert Moses; Weiner, Robert G.: Web-Spinning Heroics. Critical Essays in the History and Meaning of Spider-Man. Foreword by Tom De-Falco, Afterword by Gary Jackson. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland 2012. 261 S., ca. 35 €.
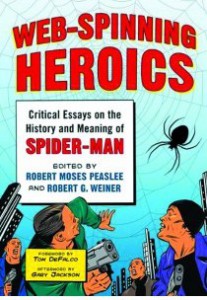 Die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zu Superheldencomics ist in den letzten Jahren, gerade im Zuge der Filmadaptionen, erfreulich gestiegen – Zuwachs ist jedoch nach wie vor willkommen. Robert M. Peaslee und Robert G. Weiner von der Texas Tech University haben nun einen ganz dem Netzschwinger gewidmeten Band zusammenges-tellt, der 24 Beiträge unterschiedlicher Länge umfasst. Die meisten Artikel sind Comic-Publikationen gewidmet, sieben Beiträge beziehen sich ganz oder teilweise auf Sam Raimis Filmtrilogie (2002–2007), drei Beiträge befassen sich mit anderen Medien.
Die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zu Superheldencomics ist in den letzten Jahren, gerade im Zuge der Filmadaptionen, erfreulich gestiegen – Zuwachs ist jedoch nach wie vor willkommen. Robert M. Peaslee und Robert G. Weiner von der Texas Tech University haben nun einen ganz dem Netzschwinger gewidmeten Band zusammenges-tellt, der 24 Beiträge unterschiedlicher Länge umfasst. Die meisten Artikel sind Comic-Publikationen gewidmet, sieben Beiträge beziehen sich ganz oder teilweise auf Sam Raimis Filmtrilogie (2002–2007), drei Beiträge befassen sich mit anderen Medien.
Obwohl der Löwenanteil der Texte von Literatur- und MedienwissenschaftlerInnen stammt, verschliesst sich Web-Spinning Heroics – wie die meiste Literatur zu Superhelden – einer zusätzlichen populärwissenschaftlichen Ausrichtung nicht: Der Sammelband ist „defined by a deliberately expansive and inclusive approach to capturing what it means to be a scholar, interpreter, teacher and fan of all things Spidey“ (17). Vorangestellt ist den Aufsätzen ein Vorwort von Tom DeFalco („My Pal Pete“) sowie die „Elegy for Gwen Stacy“ von Gary Jackson, der auch das Nachwort für den Band verfasst hat.
Die Herausgeber selbst vermerken, bei ihrer Publikation handle es sich um eine „neces-sarily incomplete collection of analyses focusing upon the popular culture phenomenon we’ve come to know, in hundreds of manifestations, as Spider-Man“ (12). Die Auswahl und Zusammensetzung der Beiträge erscheint denn auch eher willkürlich und wird nicht weiter begründet. Die sechs Teile des Buches sind nach inhaltlichen Aspekten sortiert; diese Zuordnung ist freilich nicht immer ohne weiteres nachvollziehbar.
Zum Einstieg betonen die Herausgeber in der Einleitung (4–19) Spider-Mans Bedeutung als populäre Figur, die sich auch in zahlreichen Publikationen aus Wissenschaft und Fankreisen zeige. Im Sinne eines Überblicks streifen sie mehr oder weniger zentrale Aspekte von Spider-Mans intra- und extratextueller Welt, wobei das „Drum und Dran“ des Musicals Spider-Man: Turn Off the Dark (2011) ein eigenes Unterkapitel erhält.
Im ersten Teil, dem Herzstück des Bandes, stehen „relationships between the world of Spider-Man and the culture within which he exists“ (12) im Zentrum. Den Anfang macht Phillip Lamarr Cunninghams Beitrag (22–28) über die Internet-Kampagne „Donald Glo-ver for Spider-Man“, die einen afroamerikanischen Hauptdarsteller für den jüngsten Film (The Amazing Spider-Man, 2012) vorschlug. Cunningham verortet die Argumente der Befürworter wie der Gegner in widerstreitenden Diskursen: Hier der Anspruch an die Figur Spider-Man, Universalität und somit Diversität zu symbolisieren, dort der Wunsch nach Kontinuität und Werktreue. Die Unterstützung für die Kampagne wertet er als Ausdruck eines dynamischen Umbruchs im Willen der Fans, sich über Spider-Man in einem „unlikely other“ wiederzuerkennen (23). Zwar verständlich, doch schade ist hier, dass die Beiträge offenbar bereits 2011 geschrieben worden sind und so Miles Morales, seit 2011 All-New Spider-Man, nicht einbezogen werden konnte.
Von dieser aktuellen Diskussion führt Peter Lees Beitrag (29–39) in Spider-Mans Anfangsjahre zurück. Lees Lesart präsentiert Spider-Man plausibel als Kommentar zu den sozialen Veränderungen der 60er-Jahre. Durch den Einbezug von Leserbriefen zeigt Lee, wie Marvel in den Amazing Spider-Man-Storylines die Anliegen der jugendlichen LeserInnen gezielt aufgenommen hat: Nach protestierenden Zuschriften wurden etwa Demonstranten nicht mehr als „comic relief“, sondern als „legitime“ Gruppierungen, be-sonders im Rahmen des „civil rights movement“, gezeigt. Auch anhand der älteren Figuren (Jameson, May, gewisse Schurken) legt Lee überzeugend dar, dass sich die Spannungen zwischen den Generationen – die Entfremdung der Jugendlichen von den Werten der älteren Generationen, die zwar „great power“ haben, aber „greatly irresponsible“ sind (29) – in den Spider-Man-Comics widerspiegeln.
Martin Flanagan (40–52) beleuchtet die starke Verbindung von Spider-Man mit New York und besonders die Adaption der Stadt in der Filmtrilogie. Vor dem Hintergrund theoretischer Reflexionen über das Wesen moderner Städte als Orte ständiger Bewe-gung und ständigen Wandels attestiert Flanagan New York eine „unfinished quality“; Peter/Spider-Man ist sowohl als Held wie als unscheinbarer Bewohner mit der Dynamik der Stadt eng verbunden (45). Flanagan entwirft ein differenziertes Bild der Funktionen, die Superheldenstädte in Comics und Filmen erfüllen. Die Filme zeigen (anders als E-Kultur-Repräsentationen New Yorks) eine im Grunde sozial gesunde Multikulti-Stadt, ein letztlich utopisches New York. Diese Präsentation fasst Flanagan als „reassuring vision“ (49) nach den 9/11-Anschlägen auf.
Lisa Holderman (53–62) zeigt eindrücklich auf, wie die Filme in Bezug auf physikalische Gesetzmäßigkeiten (jenseits der offensichtlichen SF-Elemente) grundlegende Fehler begehen und ein negatives Bild von Wissenschaft transportieren: Diese ist gefährlich, unkontrollierbar, sogar korrumpiert, ihre TrägerInnen sind unsorgfältig, ahnungs- und machtlos. Hier äußert sich eine populäre, in einem generellen „Anti-Intellektualismus“ verhaftete „Anti-Wissenschafts-Ideologie“. Gerade weil Superheldenfilme mit der „sus-pension of disbelief“ rezipiert werden, sind die Freiheiten in der Konstruktion der Welt („Physics-Schmysics“, 58) für Holderman umso stoßender, da sie einer „science illitera-cy“ (58) Vorschub leisten und eine kritisches Denken ablehnende Ideologie fördern.
James Bucky Carter (63–68) analysiert Ultimate Spider-Man 1–7 auf Konzepte Derridas und Blooms hin. Onkel Bens „Absenz“ etwa lässt ihn mit Derrida dennoch präsent sein. Dieser Beitrag hat dabei einen besonderen Zugang: Es handelt sich um einen Bericht über die Meriten von Ultimate Spider-Man als Unterrichtsmaterial, mit dem sich für Stu-dierende theoretische Konzepte eingängig illustrieren lassen.
Die Beiträge des zweiten Teils befassen sich jeweils mit einem bestimmten Spider-Man-Comic. David Walton (70–73) identifiziert thematische Parallelen zwischen verschiede-nen Werken J. M. DeMatteis, v. a. Kraven’s Last Hunt (1987) und DeMatteis’ autobiogra-fisch inspirierten Roman Brooklyn Dreams (1994). Die Beziehung von DeMatteis zu sei-nem Ich-Erzähler in Brooklyn Dreams ist jener von Kraven und Spider-Man vergleichbar; Schlüsselelement ist das Konzept der „true lie“. Aufgrund der Kürze (vier Seiten) lesen sich Waltons Ausführungen eher wie ein Entwurf; spätestens bei dem DeMatteis Autobiografie-Verständnis umschreibenden Satz „If fiction can be autobiography, the reverse is true, too“ (72) wäre der Einbezug gängiger Autobiografie-Theorie angebracht gewesen.
Christina C. Angel (74–80) interessiert an Neil Gaimans Marvel 1602 (2003–2005), wie literarische Charaktere auch in Resituierungen (hier: Marvel-Helden im Jahr 1602) ihre Essenz behalten können: Obwohl nur der noch nicht zu Spider-Man gewordene Peter auftritt, sei sein Alter Ego dennoch präsent, so Angel, da man als LeserIn bereits um Pe-ters Doppelidentität weiss. Spider-Man liesse sich so mit Christus vergleichen, da er in vielen Aktualisierungen seine „original formation“ überschritten und dennoch seine „original characteristics“ beibehalten habe (78). Was Angel über den Umweg der her-meneutischen Interpretation zu fassen versucht, liesse sich m. E. besser mit Intertextua-lität beschreiben, eine Verbindung damit bleibt aber aus.
Derek Parker Royal (81–88) arbeitet am Beispiel Spider-Man: Blue (2003) heraus, welches Potenzial die Wahl eines Ich-Erzählers – als Seltenheit in Marvel-Comics – für die Teilhabe der LeserInnen an Peter Parkers Innenwelt hat. Die Strategie eines homo- und intradiegetischen Erzählers (84) beinhaltet auch die Gestaltung der Panels, die bis auf wenige Ausnahmen stets aus Peters Perspektive gezeichnet sind. Royal postuliert, dass die oft erzählte Geschichte von Gwen Staceys Tod durch diese ungewöhnliche Erzählstrategie frisch und einzigartig wirke (86).
Einen etwas überraschenden Schwerpunkt setzt der Band mit dem dritten Teil um J. Jonah Jameson. Dessen polarisierende Figur unterzieht Aaron Drucker (90–100) in einem herausragenden Beitrag einer spannenden Relektüre. Er zeigt, wie sich Jameson als subtiler „antagonism within the industry itself“ verstehen lässt und für die Autoren die Möglichkeit eröffnet, die Medien zu kritisieren (91). Im Rückgriff auf Stan Lees Werdegang in der Comic-Industrie legt Drucker schlüssig dar, wie Lee in den ersten Jahren Jameson die gesamte „amalgamated world of anti-comic hysterics“ in den Mund legt und mit Heft 50 einen Wendepunkt erreicht – in der Folge dienen Spider-Man und Jameson als ökonomische Metaphern für den „Kampf“ der Comics, sich auf dem Markt zu behaupten – bis Heft 100, als Stan Lee nach den berühmten „drug issues“ Spider-Man in andere Hände gab, die auf Jamesons „kritisches Potenzial“ jedoch immer wieder zurückgriffen.
Andrew A. Smith (101–112) zeichnet nach, wie der cholerische Jameson im Lauf der Zeit zwischen negativen und positiven Eigenschaften, zwischen moralisch fragwürdigem und couragiertem Handeln mit Berufsehre, changiert. Smith liefert eine detaillierte Charakterbeschreibung, aber nur wenig mehr.
Im dritten Beitrag zu „JJJ“ vergleichen der Journalist Matthew McGowan und Jeremy Short, Professor für Management, den Daily Bugle mit den Arbeitsprozessen einer heutigen Zeitungsredaktion und versuchen, Jameson als Führungsperson zu bewerten (113–118). Peters Entlassung in The Amazing Spider-Man 623/624 etwa sei dem journalistischen Ethik-Kodex zufolge absolut gerechtfertigt. Bei den Autoren scheint dabei zuweilen ebenfalls eine Idealvorstellung des seriösen Zeitungswesens mitzuschwingen.
Im vierten Teil geht es um Spider-Mans Verhältnis zu anderen Charakteren. Cord A. Scott (120–127) zeichnet die wechselhafte Beziehung zwischen Spider-Man und dem Punisher seit ihrer ersten Begegnung bis 2010 nach. Besonders in der „maxi-series“ Civil War (2006–07) sind diese sehr verschiedenen „Anti-Heroes“ (120) durch Parallelen verbunden. Sie verkörpern, wie Scott plausibel darlegt, gegensätzliche Positionen im amerikakritischen Diskurs der Reihe bzw. erscheinen als zwei Antworten auf dasselbe Problem.
Rick Hudson (128–133) sieht in der oft proklamierten „believability“ der Spider-Man-Comics einen massgeblichen Erfolgsfaktor. Diese liege nicht nur bei Spider-Man als „Anti-Hero“, sondern genauso bei vielen seiner Superschurken als „Anti-Villains“. Diese – Paradebeispiel „Sinister Six“ – seien nicht „ultimate villains“ (129) wie ein Joker oder ein Lex Luthor, sondern verkrachte Existenzen, denen der Erfolg verweigert wurde. So einleuchtend diese Argumentation ist, lässt sich doch bezweifeln, ob „Anti-Villain“ ein glücklicher Begriff ist, zumal – dies betrifft auch den Beitrag zuvor – sich darüber strei-ten lässt, ob Spider-Man ohne weiteres als „Antiheld“ zu bezeichnen ist.
Phillip Bevin (134–143) unterzieht die Origin Storys Spider-Mans und Batmans im Crossover Disordered Minds (1995) einer minutiösen Interpretation mit Judith Butlers Gender- und Identitätstheorie, v. a. dem „performativity“-Aspekt. Der Verlust einer Vaterfigur, die angesichts ihrer Mörder „Passivität“ „performiert“, hat dabei unterschiedliche Folgen: Batman versuche durch eine besonders (normativ-) „männliche“ Performance, dies zu kompensieren. Spider-Mans Figur dagegen beweise, dass „failing to live up to an idealized vision of normative perfection“ (143) ebenfalls produktiv sein könne. Leider bleibt die Analyse auf die Origin Storys beschränkt; wie sich die „Friendship through Difference“ in Hudsons Titel bei den beiden Helden äussert, bleibt unerwähnt.
Thema des fünften Teils ist „Trauma“. Forrest C. Helvie (146–154) zeigt auf, dass Peter in den frühen Amazing Spider-Man-Jahren „klassische“ Phasen der Trauma-Bewältigung durchläuft. Die Spider-Man-Rolle erscheine so als „cathartic reenactment“ (152), womit der Jugendliche das erlittene Trauma überwinde. Dies sind mehrheitlich bedenkenswerte Nuancen, doch wird das Potenzial der Analyse nicht ausgeschöpft, da Bezüge auf den auch für den erwachsenen Peter immer wieder zentralen Schuld-Komplex fehlen.
Tama Leaver (154–164) greift nochmals die Spider-Man-Filmtrilogie als Antwort auf das Trauma von 9/11 auf. Leaver zufolge fungieren die Filme allegorisch als „significant cultural arena“ (154), da sie Spannungen der Post-9/11-Welt aufnehmen. Symptomatisch dafür ist der berühmte Trailer von 2001, der nach den Anschlägen zurückgezogen wurde und ebenso ein „Geist“ geworden sei wie die „Towers“ (155). Tatsächlich finden sich die „Towers“ bei genauem Hinsehen als „CGI homage“ (159) noch im fertigen Film, obwohl explizite Hinweise vermieden wurden. Die Trilogie zeige eine „artificial culture in which old binary divisions blur“ (163) und stelle eine Art von „Artificial Mourning“ dar, das den ZuschauerInnen ermöglicht, sich subjektiv mit den Ereignissen von 9/11 zu befassen. Der Beitrag wäre mit Gewinn direkt nach Flanagans positioniert gewesen (u. a. berufen sich beide auf Scott Bukatmans Matters of Gravity, 2003).
Den gender-fokussierten sechsten Teil eröffnen Robert G. Weiners (166–176) Betrachtungen über Peters Liebesbeziehung zu Mary Jane in den Comics (anhand dreier Statio-nen: erste Begegnung, Hochzeit und One More Day) sowie in der Filmtrilogie, die die ro-mantische Handlung klar betont. Mary Jane, folgert Weiner etwas oberflächlich, sei trotz ihrer damsel-in-distress-Funktion in beiden Medien eine starke Frauenfigur, die die Risiken, Spider-Mans Geliebte zu sein, akzeptiere.
Emily D. Edwards These (177–187) betrifft die Frauen im Kinosaal: „Women’s Pleasures Watching Spider-Man’s Journeys“ lägen in der Identifikation mit Jung’schen Archetypen. Die Filmtrilogie entspreche, wie sie detailliert erläutert, Campbells auf Männer zugeschnittener Heldenreise. In Interviews mit weiblichen Fans spürt sie verschiedene Interpretationen auf, die die Handlung zuvorderst als Liebesgeschichte werten. Dass sich Frauen dennoch, z. T. über die Maskerade, eher mit Peter als mit Mary Jane identifizierten, sieht Edwards als Zeichen dafür, wie Minderheiten gelernt haben, sich durch „alternate readings“ in Hollywoods typisch weiss-männlichen Helden wiederzuerkennen.
Im Rückgriff auf Konzepte von Eco, Jung und Campbell erläutert Ora C. McWilliams (187–194) diverse Widersprüche in der Figur von Peters Tante. Viele Jahre war May vor allem „unbelehrbar“, aber immer wichtig für Peters Persönlichkeit. Sie zeigt, dass Mays Charakter unter Autor J. Michael Straczynski komplexer wurde – der Reboot in One More Day (2007) machte diese Entwicklung jedoch zunichte.
Robert M. Peaslees Beitrag (195–208), bereits 2005 in „Psyart“ publiziert, macht in den ersten beiden Filmen aus Raimis Trilogie zentrale psychoanalytische Motive ausfindig. Aus dieser Perspektive nachvollziehbar, erörtert er ödipale Strukturen in Peters Bezie-hungen, seine Doppelidentität und die Spaltung zwischen Bewusst- und Unbewusstsein.
Der letzte Teil des Buches stellt „under-examined Spider-texts“ in den Fokus. David Ray Carter (210–221) legt erfrischend dar, wie Spider-Man: The Animated Series (1994–1998) durch den Medienwechsel eine Neukonzeption vornehmen musste – und durch die Reinterpretation der „mythologischen“ Elemente und innovative serielle Span-nungsbögen ihre Eigenständigkeit bewies.
Mark McDermott hat weitherum vergessene Artefakte ausgegraben: „Spider-Man Music LPs“ (222–233). Sie waren, so McDermott, der Versuch, Spider-Mans Geschichte als eine Art „rock opera comic book“ (223) zu adaptieren, um eine neue Leseerfahrung zu bieten (The Amazing Spider-Man: From Beyond the Grave, 1972; Spider-Man: Rock Reflections of a Superhero, 1975). McDermott situiert diese Werke sowie The Marvel World of Icarus (1972) fundiert im Kontext der „rock opera“.
Im letzten Beitrag betont Casey O’Donnell (234–247), dass es sich bei Games nicht um „convergence culture“ handle. Er zeigt aufgrund des Produktionsprozesses von zwei Spider-Man 3-Games, dass diese technisch und inhaltlich kaum zu vergleichen sind. Die „magische“ Kompatibilität (der media flow), das werde oft vergessen, entstehe stets aus unzähligen Stunden bewusster Arbeit (235). O’Donnells Beitrag ist sicher aufschluss-reich für Game-Forschende (und auch für Nicht-ExpertInnen gut lesbar), über die Spi-der-Man-Games selbst erfährt man aber weniger als erwartet.
Die Beiträge in „Web-Spinning Heroics“ geben spannende Einblicke ins Spider-Verse. Dennoch lassen sich einige Punkte bemängeln: Die meisten Beiträge zu den Comics ge-hen kaum auf die Bildebene ein (Ausnahmen: Belvis, Royal). Während dies bei der Lek-türe der einzelnen Beiträge nicht stört, erscheint dies für einen Band um einen Comic-Helden doch eher unglücklich. Umso bedauerlicher ist der Verzicht auf Abbildungen.
Liest man den Band am Stück, sind die Basisinformationen, die jeder Artikel freilich leisten muss, mit der Zeit etwas ermüdend. Dies gilt auch für die wiederholten Aussagen darüber, was Spider-Man so einzigartig und erfolgreich mache. Die oft unreflektierten und fast gebetsmühlenartigen Beteuerungen, Spider-Man sei „einer wie wir“, ein „Normalo“, wecken so eher Widerspruch. Dabei fällt auf, dass Spider-Man fast immer mit Superman und Batman, allenfalls noch mit der Fackel, verglichen wird, jedoch kaum mit jenen Helden, die ihm jedenfalls zeitweilig viel ähnlicher waren – nämlich den Marvel-eigenen Daredevil, Iron Man oder den X-Men. An einigen Stellen hätte man sich auch einen (stärkeren) Einbezug der bereits länger vorliegenden Aufsätze zu Spider-Man-Werken gewünscht.
Ärgerlicherweise geben einige Aufsätze das Publikationsjahr ihres spezifischen Gegens-tandes nur in der Bibliographie, nur für den Sammelband oder gar nicht an. Angesichts der Unmengen von Spider-Man-Medien darf man aber nicht erwarten, dass die LeserInnen schon wissen, wann diese oder jene Storyline geschaffen wurde.
Insgesamt werfen die Beiträge des Bandes alle erhellende Schlaglichter auf Spider-Mans multimediale Welt; ganz ausgeleuchtet wird sie damit aber noch lange nicht. Fachlich an Spider-Man Interessierte werden mit diesem Band zu vielen Themen fündig, das definitive Spider-Man-Buch liegt hier aber nicht vor: Zum einen ist die Produktion dem Band schon wieder einige Meilensteine voraus (All-New Spider-Man, neuster Film). Zum andern sind die einzelnen Beiträge denn doch von zu heterogener Qualität – hier und da würde man sich einen genaueren, strukturierteren Blick wünschen –, und trotz aller Diversität sind letztlich alle Texte Werkanalysen, welche etwa Rezeptionsfragen nur am Rande ansprechen. Welche Texte am hellsten „leuchten“, dürfte – wie immer – wohl von den eigenen Interessen und Vorlieben bezüglich Zugängen und Theorien abhängen.
Aleta-Amirée von Holzen, Zürich, 2012