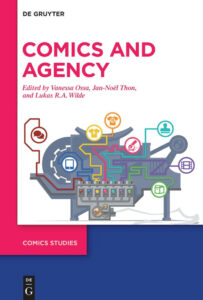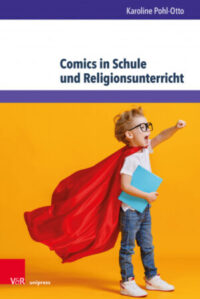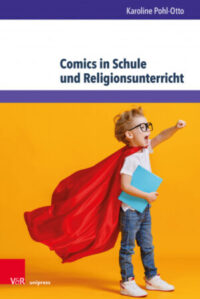 Rezension zu:
Rezension zu:
Karoline Pohl-Otto: Comics in Schule und Religionsunterricht: Vielfalt adressieren, Kompetenzen fördern, Unterricht verbessern
V&R unipress, 2021
Arbeiten zur Religionspädagogik, Bd. 73
ISBN: 978-3-8471-1372-0
Zur Verlagswebsite
Rezensiert von:
Anja Lange
Über das Thema ‚Comics in der Schule‘ ist bereits viel geschrieben worden und es stehen den Lehrkräften und Schüler_innen vielfältige Fachartikel und sogar eigene Comicgeneratoren im Internet zur Verfügung1. Auch zum Thema ‚Comic und Religionsunterricht‘ liegen bereits fachdidaktische und populärwissenschaftliche Arbeiten und Analysen vor2. Wieso braucht es nun noch einen Beitrag zum Thema ‚Comic und Schule‘, respektive ‚Comic und Religionsunterricht‘?
Karoline Pohl-Ottos 607 Seiten starkes Werk ist ein Kompendium, das sich lohnt, soviel sei bereits zu Beginn gesagt. Sie verbindet gekonnt Theorie mit Praxis anhand ausgewählter Beispiele. Diese Verbindung stellt die größte Stärke des Buches dar, denn man findet in den vorher zitierten Quellen entweder stark theoretische Arbeiten (bspw. Dahrendorf) oder praktische Unterrichtsentwürfe (bspw. „Mein eigener Comic“). Pohl-Otto gelingt es vor allem, umfangreich recherchierte Theorie mit analysierter Praxis zu verbinden.
Beginnend mit begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen und einer Einführung in das Medium Comic (plus einer ausführlichen Charakteristik des Mediums) bietet der umfangreiche Band Informationen für Neulinge gleichermaßen wie für Kenner der Materie. Besonders die gegenwärtigen Fragestellungen zum Comic laden zum weiteren Forschen ein und stellen einen großen Mehrwert der Publikation dar.
Pohl-Ottos Ausgangspunkt könnte aktueller nicht sein: Sie geht von einer kulturellen, weltanschaulichen und sprachlichen Vielfalt aus, wie sie in deutschen Schulen heutzutage die Regel ist. Gleichzeitig hat Pohl-Otto eine große Mission: Sie will die zunehmend kirchenfernen Jugendlichen mit Comics zurück in den Religionsunterricht bringen. Dies soll u.a. dadurch erreicht werden, dass den Jugendlichen einerseits Gehaltvolles beigebracht wird und sie andererseits durch die Verwendung eines aus ihrem Alltag vertrauten Mediums in ihrer Lebenswelt ernstgenommen werden (vgl. Pohl-Otto, 11). Ob das gelingt, wenn ihr Ansatz im Unterricht benutzt wird, kann an dieser Stelle nicht geprüft werden. Kein Zweifel besteht darüber, dass die Behandlung von Comics für Kinder und Jugendliche interessant ist, das ist neben anderen ein Ansatzpunkt Pohl-Ottos, den sie konsequent vertritt. Das Interesse an Comics käme daher, dass sie am „Puls der Zeit“ (Pohl-Otto, 11) lägen und sie als Massenmedium noch immer den digitalen Angeboten trotzen würden (vgl. Pohl-Otto, 11-12). Gerade in der Papierform besäßen Comics noch immer eine große Anziehungskraft auf die Jugendlichen (Pohl-Otto, 552).
Sie will den Nutzen von Comics in Lernkontexten systematisch analysieren und tut dies nicht nur gut recherchiert, sondern auch lesbar aufgearbeitet, samt einer Einführung in die Grundlagen der Comicstudien, die sie mit der Pädagogik verbindet. Anschaulich zeigt Pohl-Otto außerdem, wie in der Religionspädagogik Comics stiefmütterlich behandelt wurden. Daher analysiert sie Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Religionspädagogik, der Unterrichts- und Comicforschung und der Schulpädagogik, was eine wahrlich große Aufgabe war.
Pohl-Ottos Aufbau des Buches ist dabei sehr gut nachvollziehbar und leserfreundlich: Vom allgemeinen Medium Comic kommt sie zur Fachdidaktik der Religion und stellt schließlich zwei einzelne Werke, Persepolis von Marjane Satrapi und den Band Onkel Dagobert: Sein Leben, seine Milliarden von Don Rosa für den Religionsunterricht vor. Dieser Aufbau macht das Werk auch für andere Fächer, beispielsweise den Deutsch- oder Ethikunterricht, interessant, da die Analysekategorien ohne Weiteres auch in diesen Fächern im Unterricht didaktisiert werden können.
Es verwundert, dass in dem breit angelegten Werk lediglich 35 Abbildungen zu finden sind – wer auf eine reich bebilderte Illustration gehofft hat, wird von Pohl-Ottos Werk enttäuscht sein. Die wenigen Illustrationen tun der Comicanalyse jedoch keinen Abbruch, denn sie ist der mit Abstand interessanteste Teil des Werkes. Die Auswahl der Comics zur Illustration der Analyse könnte unterschiedlicher nicht sein: Persepolis zog eine „enthusiastic worldwide reception“ (Simidchieva, 88) nach sich und Onkel Dagobert: Sein Leben, seine Milliarden ist nur vermeintlich ein purer Comic für Kinder: Gerade in diesem ausgiebigen Werk rund um die bekannte Figur aus Entenhausen analysiert Pohl-Otto „existentielle, philosophische und theologische Themen“ (Pohl-Otto, 471), die man in dem Comic auf den ersten Blick nicht erwartet hätte. Die umfangreiche Comicanalyse wird jeweils von einer kurzen Zusammenfassung des Inhalts bzw. der Kapitel begleitet. Es werden inhaltliche Aspekte analysiert, beispielsweise von „Identität und Entfremdung“ (Pohl-Otto, 476). Diese Kategorien sind universell und können analog in anderen Comics herangezogen werden. Eine selbstständige Weiterarbeit bzw. Didaktisierung anderer Werke ist damit für Lehrende kein Problem. Aber auch als Inspiration und Fundgrube eignet sich Pohl-Ottos Werk hervorragend, da sie viele Anhaltspunkte zum weiteren Forschen und Didaktisieren bietet.
Ebenfalls sehr interessant sind die 12 Thesen, die sie für den Einsatz von Comics in Schule und Religionsunterricht aufstellt. Diese können als Zusammenfassung ihrer Arbeit bewertet werden und veranschaulichen kurz und prägnant, wieso sich Pohl-Otto für den Einsatz von Comics im Unterricht ausspricht. Sie sieht Comics als „Chancengeber im Unterricht“ (Pohl-Otto, 111), das wird von der ersten bis zur letzten Seite deutlich. Comics können im Unterricht dann „Wirkkraft entfalten“ (Pohl-Otto, 111), wenn sie dazu benutzt werden, schülerzentriert zu unterrichten, an die Lebenswelt der Jugendlichen anzuknüpfen und ein lernproduktives Klima zu schaffen. Somit sind sie für die Lehrkräfte und die Schüler_innen Chancengeber. Klar benennt Pohl-Otto die Vorteile eines Comiceinsatzes im Unterricht, gibt jedoch auch zu bedenken, dass viele Lehrkräfte eine geringe Fachkompetenz im Bereich Comics besitzen. Diese kann durch das Durcharbeiten des Buches sicher erheblich gesteigert werden!
Fazit:
Pohl-Ottos Werk eignet sich besonders für Lehrkräfte, die sich intensiv mit dem Thema „Comics“ beschäftigen wollen und nicht nur bei dem Ausfüllen von Sprechblasen3 bleiben wollen. Sie zeigt, wie man mit Gewinn Comics im Unterricht gewinnbringend behandeln und lernerzentriert unterrichten kann. Die von ihr aufgestellten Analysekategorien können ohne Weiteres ebenso auf Romane oder Filme angewendet werden und sind sicher auch für eine Behandlung in anderen Unterrichtsfächern interessant. Daher ist Pohl-Ottos Kompendium nicht nur für den Religionsunterricht zu empfehlen, sondern bietet für alle Lehrenden, die sich mit Comics im Unterricht beschäftigen möchten, wertvolle Anhaltspunkte.
Über die Verfasserin:
Anja Lange ist DAAD-Lektorin am Kirgisisch-Deutschen Institut für Angewandte Informatik in Bischkek, Kirgistan. Sie studierte Slawistik in Leipzig und Kyjiw, Ukraine. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Fachdidaktik und im Fachsprachenunterricht.
Publikationen im Bereich Comic:
- “The Beginning of Ukrman – a Fighter Against the Evil and the Coronavirus” (in: Galactica Media: Journal of Media Studies Bd. 2, Nr. 3, 2020, S. 245-272)
- “Daohopak, a Comic Series about Cossacks as Part of the Identity Formation of Ukraine” (in: Bernd Dolle-Weinkauff, Hg.: Geschichte im Comic: Befunde – Theorien – Erzählweisen, Christian A. Bachmann Verlag, 2017, S. 157-170).
[1] Beispielsweise der Aufsatz von Malte Dahrendorf „Comics in der Schule: Ein Unterrichtsmodell“, mit welchem bereits 1977 eine Handreichung zur Arbeit mit Comics im Unterricht angeboten wurde, und die Mappe Comics in der Schule von Petra Lange-Weber, die auf spielerische Art und Weise u.a. Bildperspektiven von Schüler_innen untersuchen lässt. Auch die vielen Onlineangebote, beispielsweise „Mein eigener Comic“ (https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichtsmaterialien/detail/mein-eigener-comic/) bestehen aus didaktisierten Materialien.
[2] Hier muss der Fachdidaktische Beitrag von Reiner Riedel erwähnt werden, in dem eigene Comics im Religionsunterricht erstellt werden, oder auch der Bibelcomic „Am Anfang war der Teig“.
[3] In einigen Publikationen zum Thema „Comic in der Schule“ kommt es vor allem darauf an, Sprechblasen auszufüllen, so beispielsweise „Mein eigener Comic“ vom Medienkompetenzrahmen NRW.
Literatur
- Dahrendorf, Malte: „Comics in der Schule: Ein Unterrichtsmodell.“ In: Fuchs, W.J. (Hgs) Comics im Medienmarkt, in der Analyse, im Unterricht. Schriftenreihe des Institut Jugend Film Fernsehen, Bd. 1. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1977. S. 149–162. https://doi.org/10.1007/978-3-322-89768-8_20
- Heinze, Andrea: „Religion im Comic: Am Anfang war der Teig.“ Deutschlandfunk, 2018. https://www.deutschlandfunk.de/religion-im-comic-am-anfang-war-der-teig-100.html
- Lange-Weber, Petra: Comics in der Schule: Merkmale, Gestaltung, Sprache. Bergedorfer Kopiervorlagen Bd. 252. Persen Verlag, 2010.
- „Mein eigener Comic.“ Medienkompetenzrahmen NRW, LVR Zentrum für Medien und Bildung, Düsseldorf, 2022. https://medienkompetenzrahmen.nrw/unterrichtsmaterialien/detail/mein-eigener-comic/
- Riedel, Reiner: „Erzählen mit Bildern.“ In: rpi-Impulse: Beiträge zur Religionspädagogik aus EKKW und EKHN Bd. 1, 2018,. S. 23-25.
- Simidchieva, Marta: “Marjane Satrapi’s Persepolis through the Lens of Persian Historiagraphy.” International Journal of Persian Literature, Bd. 2, 2017, S. 87-137.

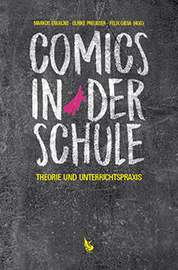 Rezension zu:
Rezension zu: